| Leben & Wirken |
Heinrich der Löwe (* um 1129/30 oder 1133/35; † 6. August 1195 in Braunschweig) aus dem Geschlecht der Welfen war von 1142 bis 1180 Herzog von Sachsen (als Heinrich III.) sowie von 1156 bis 1180 Herzog von Baiern (als Heinrich XII.).
Heinrich der Löwe hatte 1152 als Herzog von Sachsen entscheidenden Anteil an der Königskrönung seines Vetters Friedrich Barbarossa. Dafür wurde er von Barbarossa in den folgenden Jahren intensiv gefördert. So erhielt er im Jahr 1156 auch das bayerische Herzogtum. In Norddeutschland konnte Heinrich eine königsgleiche Stellung aufbauen. Braunschweig machte er durch den Neubau der Stiftskirche St. Blasius und der benachbarten Burg Dankwarderode mit dem Standbild eines Löwen zu einem fürstlichen Repräsentationszentrum. Der aggressive Herrschaftsausbau des Herzogs in Sachsen und nördlich der Elbe rief allerdings den Widerstand der anderen sächsischen Großen hervor. Für die Unterstützung durch Barbarossa revanchierte sich Heinrich zunächst durch große Anstrengungen im Reichsdienst während der ersten Italienzüge.
Im Jahr 1176 wurde das Verhältnis jedoch schwer belastet, als sich der Herzog weigerte, angesichts eines bevorstehenden Kriegs mit den lombardischen Städten den Kaiser in einer bedrohlichen Situation militärisch zu unterstützen. Nach der Niederlage Barbarossas, dem Scheitern der Oberitalienpolitik und dem Friedensschluss von 1177 mit dem lange bekämpften Papst Alexander III. wurde Heinrich der Löwe auf Bestreben mehrerer Fürsten gestürzt und musste ins Exil nach Südengland gehen, aus dem er erst Jahre später zurückkehren konnte. Neben Friedrich Barbarossa galt er lange Zeit als wichtigster Protagonist des staufisch-welfischen Gegensatzes, der die Reichspolitik im 12. Jahrhundert dominiert habe. Erst in jüngster Zeit wurde diese Einschätzung stark relativiert.
Herkunft
Heinrich der Löwe entstammte dem adligen Geschlecht der Welfen. Schon seit den zwanziger Jahren des 12. Jahrhunderts entstanden mehrere Schriften, in denen die Geschichte dieser Familie mit wechselnden Akzentsetzungen schriftlich fixiert wurde; die Welfen waren damit die erste Adelsfamilie im Reich, die ihre Geschichte aufzeichnen ließ.[3] Die Hausüberlieferung, die in der Genealogia Welforum, der so genannten Sächsischen Welfenquelle und der Historia Welforum zum Ausdruck kam, hob die Verbindung mit den Karolingern hervor und betonte die Bedeutung des Leitnamens Welf, der über die Namensetymologie catulus (= Welpe) einen Bezug zum antiken Rom ermöglichte.
Die Vorfahren der Welfen traten bereits im 8. Jahrhundert im Umfeld der Karolinger auf. Der Aufstieg der Familie vollzog sich durch vorteilhafte Heiraten. Die Welfin Judith hatte als zweite Gemahlin des Kaisers Ludwig des Frommen maßgeblichen Einfluss auf die Geschichte des fränkischen Großreiches. Ihre Schwester Hemma wurde mit Judiths Stiefsohn, König Ludwig dem Deutschen, verheiratet. Die zweifache Eheverbindung mit dem karolingischen Herrscherhaus sicherte den Aufstieg im Umkreis der Könige. Nach dem Zerfall des fränkischen Großreiches stellte bis 1032 ein Zweig der Familie die Könige von Burgund. Nach dem Tod Welfs III. im Jahr 1055, der ohne Erben starb, geriet das Haus in eine Existenzkrise. Seine Schwester Cuniza heiratete den Markgrafen Azzo II. von Este, der aus heutiger Sicht das Geschlecht fortführte.
Der Großvater Heinrichs des Löwen, der bayerische Herzog Heinrich der Schwarze, heiratete Wulfhild, die älteste Tochter des sächsischen Herzogs Magnus Billung und der ungarischen Königstochter Sophia. Größere Ländereien um Lüneburg, den Zentral- und Begräbnisort der Billunger, gelangten dadurch an die Welfen. 1123 steigerte die Heiligsprechung Bischof Konrads von Konstanz, eines Angehörigen des Hauses, das Ansehen der Familie. Die Welfin Judith, Tochter Heinrichs des Schwarzen, heiratete den staufischen Herzog Friedrich II., den Vater Friedrich Barbarossas. Die Kandidatur Friedrichs II. als Nachfolger des kinderlos gestorbenen salischen Herrschers Heinrich V. blieb 1125 erfolglos. Gewählt wurde stattdessen der Sachsenherzog Lothar III. Entscheidend dafür war der Parteiwechsel Heinrichs des Schwarzen, der nicht seinen staufischen Schwiegersohn, sondern den sächsischen Herzog Lothar bei der Königswahl unterstützte. Lothar gewann ihn für sich, indem er seine einzige Tochter Gertrud mit Heinrichs Sohn, Heinrich dem Stolzen, vermählte. Aus dieser Verbindung ging Heinrich der Löwe hervor. Sein Geburtsort ist ungewiss.[4] Nach der Steterburger Chronik müsste er 1129/1130 geboren sein.[5] Die Zeit bis zum Tauftermin 1135/36 scheint jedoch zu lang zu sein und der Kopist der einzigen Sammelhandschrift könnte einen Übertragungsfehler begangen haben, so dass Heinrich auch 1133/35 geboren sein könnte.[6] Heinrich der Stolze erlangte in der folgenden Zeit eine überherzogliche, nahezu königsgleiche Stellung. Am Ende der Regierungszeit seines Schwiegervaters Lothar verfügte er über die Herzogtümer Bayern und Sachsen, über die Markgrafschaft Tuszien, die Mathildischen Güter sowie über umfangreichen Eigenbesitz in Schwaben, Bayern, Sachsen und Italien. [2] |
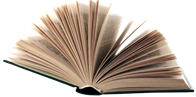
![Herzog Heinrich III/XII [Welfen] von Braunschweig, „der Löwe"](img/male.jpg)
 [1, 3]
[1, 3]  gest. 28 Jun 1189, Braunschweig, (DE)
gest. 28 Jun 1189, Braunschweig, (DE)  (Alter 32 Jahre)
(Alter 32 Jahre)  gest. 12 Dez 1213, Lüneburg, Niedersachsen, (DE)
gest. 12 Dez 1213, Lüneburg, Niedersachsen, (DE)  (Alter 29 Jahre)
(Alter 29 Jahre) gest. 12 Dez 1213, Lüneburg, Niedersachsen, (DE)
gest. 12 Dez 1213, Lüneburg, Niedersachsen, (DE)  (Alter 29 Jahre)
(Alter 29 Jahre) gest. 1204 (Alter 31 Jahre)
gest. 1204 (Alter 31 Jahre) (Alter 15 Jahre)
(Alter 15 Jahre) gest. 19 Mai 1218, Harzburg, Tettens, Tettens, Jever, Oldenburg, (DE)
gest. 19 Mai 1218, Harzburg, Tettens, Tettens, Jever, Oldenburg, (DE)  (Alter 43 Jahre)
(Alter 43 Jahre) gest. 1 Jul 1196, Savoyen, Haute-Savoie, Rhone-Alpes, (FR)
gest. 1 Jul 1196, Savoyen, Haute-Savoie, Rhone-Alpes, (FR)  (Alter 63 Jahre)
(Alter 63 Jahre)  gest. 6 Jan 1197 (Alter 42 Jahre)
gest. 6 Jan 1197 (Alter 42 Jahre) gest. 28 Apr 1227, Braunschweig, Niedersachsen, (DE)
gest. 28 Apr 1227, Braunschweig, Niedersachsen, (DE)  (Alter 54 Jahre)
(Alter 54 Jahre)
