| Leben & Wirken |
Heinrich Karl Ernst Grüber war ältester Sohn eines Hauptschullehrers, der als Junge von einem französischen General erzogen worden war. Heinrich Grübers Vater legte daher großen Wert darauf, dass sein Sohn mit der französischen Sprache und Kultur konfrontiert wurde. Sein Vater erlitt im Alter von 37 Jahren einen schweren Unfall und wurde pensioniert, woraufhin Geldsorgen die Familie Grüber stark belasteten. In seiner Schulzeit erhielt Heinrich Grüber einen Preis des preußischen Kultusministeriums für seine schulischen Leistungen. Er war der einzige evangelische Schüler seiner Klasse. Nach dem Abitur in Eschweiler trat er das Studium der Philosophie, Geschichte und Theologie in Bonn, Berlin und Utrecht an. Seine Mutter war eine gebürtige Niederländerin aus Gulpen, daher war ihm die niederländische Sprache und Kultur bekannt. 1914 legte er sein erstes theologisches Examen am Berliner Domkandidatenstift ab. Sein Dienst in der Evangelischen Landeskirche der älteren Provinzen Preußens als Pfarramtsvertreter in einer Gemeinde in Beyenburg (zu Wuppertal), in der Sozialarbeit in Stolberg und ein Stipendium in Utrecht verzögerten seine Einberufung als Soldat im Ersten Weltkrieg, er diente vom Januar 1915 bis zum Frühjahr 1918 als Feldartillerist. Anschließend absolvierte er dann einen Lehrgang zum Militärpfarrer in Bonn. Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete Grüber in den kirchlichen sozialen Diensten, unter anderem seit 1926 als Leiter in einem Heim für schwach begabte und verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, das zur diakonischen Stephanus-Stiftung Waldhof in Templin gehörte.
Er war Mitglied des Nationalen Clubs, einer konservativen Gruppierung, die auch zum Stahlhelm Kontakte hatte, und kam so nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler sogar als Staatssekretär des Stahlhelmführers und neuernannten Reichsarbeitsministers Franz Seldte ins Gespräch. Im Laufe des Jahres 1933 wandte sich Grüber aber gegen die nun offen erkennbare nationalsozialistische Diktatur und schloss sich dem Pfarrernotbund an, nicht zuletzt, da der Arierparagraph auch Christen jüdischer Herkunft betraf.[1] Am 2. Februar 1934 ernannte das Domkirchenkollegium (Gemeindekirchenrat der Evangelischen Gemeinde der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin) – im Rahmen seiner Patronatsrechte an der Jesuskirche in Kaulsdorf – Grüber zum Pastor der dortigen Kirchengemeinde.[2] Die von Hitler entgegen den Kirchenordnungen angeordneten Kirchenwahlen am 23. Juli 1933 hatten den Deutschen Christen die Mehrheit im Gemeindekirchenrat Kaulsdorfs gebracht, entsprechend protestierte er gegen Grübers Berufung beim zuständigen Konsistorium der Mark Brandenburg.[3] Das Konsistorium bestand aber auf Grübers Berufung, da der Willen des Patrons dem der Gemeinde voranginge.[4]
Das Amt des Pastors schloss den Vorsitz im Gemeindekirchenrat von Amts wegen ein, so dass Konflikte unvermeidlich waren. Deutschchristliche Älteste erhoben Beschwerde gegen Grüber beim Konsistorium für seine Kritik am altpreußischen Landesbischof Ludwig Müller, nationalsozialistische Kirchgänger denunzierten ihn bei der Gestapo für seine Kritik an den Sterilisationsgesetzen des NS-Regimes (siehe Euthanasie und Eugenik) und seine Kritik am staatlichen Antisemitismus.[5] Seine Gottesdienste in der Jesuskirche fielen dadurch auf, das er gegen den Personenkult um Hitler, die zunehmende Aufrüstung Deutschlands und den Antisemitismus predigte.[6]
Grüber begann eine Bekenntnisgemeinde in Kaulsdorf aufzubauen. Seine Berufung wurde Anhängern der Bekennenden Kirche in anderen Kirchengemeinden des Kirchenkreises Berlin Land I bekannt und manche gingen fortan sonntags zum Gottesdienst in die Jesuskirche.[7] Am 22. Dezember 1934 erhielt er den vierten überhaupt ausgestellten – ihrer Farbe wegen Rote Karte genannten – Mitgliedsausweis der Bekenntnisgemeinde in Kaulsdorf.[8]
Grüber ermutigte auch zur Gründung weiterer Bekenntnisgemeinden, z. B. in Friedrichsfelde am 1. Februar 1935.[9] Am 3. März 1935 konstituierte sich die Kreisbekenntnissynode mit Synodales aus den Bekenntnisgemeinden des Kirchenkreises und wählte Grüber zum Vertrauensmann.[10] Da der den Kirchenkreis leitende Superintendent Ludwig Eiter nicht offen zur Bekennenden Kirche stehen mochte, erfüllte Grüber auch die Aufgabe des Kreispfarrers der Bekennenden Kirche wie vorgesehen, wenn der Superintendent nicht selber zur Bekennenden Kirche hielt. Eine enge Freundschaft verband ihn seit dieser Zeit mit Martin Niemöller.
Wenn Grüber selbst an Sonntagen verhindert war, sorgte er für eine Vertretung durch die Bekennende Kirche. So predigte im August vertretungsweise sein Köpenicker Kollege Pastor Neumann kritisch über den Antisemitismus des NS-Regimes, was ihm gleich eine Denunziation seitens des Gemeindekirchenrates eintrug.[6]
Anlässlich der Rheinlandbesetzung dekretierte Hitler für den 29. März 1936 Neuwahlen für den Reichstag. Der 29. März war Palmsonntag, der traditionelle Tag, an dem die Konfirmanden eingesegnet wurden. Wilhelm Zoellner, 1935–1937 Leiter des Reichskirchenausschusses und damit Vertreter der kirchlichen Kompromisspolitik gegenüber dem NS-Regime, betrachtete die Festlegung dieses Wahltages als unfreundlichen Akt gegen den deutschen Protestantismus. Dennoch war er zu Kompromissen bereit und ersuchte die Deutsche Arbeitsfront (DAF), den Beginn des obligatorischen Landarbeitsdienstes für Jugendliche um eine Woche zu verschieben. Doch die DAF lehnte ab.
Die zweite Vorläufige Kirchenleitung der reichsweiten Bekennenden Kirche vertrat die Ansicht, die Gemeinden und Pastoren sollten die Konfirmationen wie üblich abhalten. Da aber Väter von Konfirmanden, sei es als Ehrenamtliche oder NS-Parteigenossen als Wahlhelfer zur Durchführung der Wahlen abgestellt waren, und deutschlandweit zugleich viele tausend Verwandte und Paten zu Konfirmationsfeiern reisen würden, befürchtete die NS-Führung eine niedrigere Wahlbeteiligung. Dadurch wurde die Konfirmation am 29. März ein Politikum.
Schließlich trauten sich nur wenige Pastoren, die Konfirmation am 29. März durchzuführen, Grüber war einer von ihnen (einer von 13 in Berlin).[11] Älteste schwärzten Grüber daraufhin erneut beim Konsistorium an.[12] Der Leiter der traditionsreichen NSDAP-Ortsgruppe Kaulsdorf, der ältesten in den östlichen Vororten Berlins, drohte Grüber an, dafür zu sorgen, dass er ins Konzentrationslager komme.[6]
1936 wählte die Calvinistische Gemeinde in Berlin lebender Niederländer Grüber zu ihrem Pastor, was er bis zu seiner Verhaftung 1940 blieb.[13] 1937 wurde Grüber erstmals von der Gestapo verhaftet. Eine Begründung der Gestapo ist nicht erhalten, doch können „illegale Schriften“ und hektografierte „Rundbriefe an die evangelischen Familien in Kaulsdorf“, in der er sich unter anderem gegen die Umwandlung einer Zweigschule einer Pflegeanstalt in eine staatliche Gemeinschaftsschule aussprach, einen Anlass geboten haben.[14] [1] |
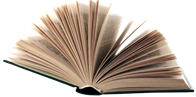

 [1]
[1]  [1]
[1] 



