| Leben & Wirken |
Wilhelm Kohlen * 14. Dezember 1896 in Gressenich (seit 1972 Stolberg (Rhld.) bei Aachen, † 31. Oktober 1964 ebenda, war sozialdemokratischer Politiker und Landrat des Kreises Aachen. Wilhelm Kohlen wuchs im Stolberger Stadtteil Mausbach auf. 1910 bis 1914 machte er eine Ausbildung zum Druckereifacharbeiter. Den Ersten Weltkrieg erlebte er von 1914 bis 1918 als Soldat. 1919 bis 1929 wechselte er seinen Beruf und wurde Metallfacharbeiter. 1929 bis 1931 war er arbeitslos. Um der Arbeitslosigkeit zu entkommen, gründete er 1931 ein Handelsunternehmen, das er bis 1933 leitete. 1933 wurde Wilhelm Kohlen von den Nationalsozialisten verhaftet und von Januar bis März 1933 erstmalig inhaftiert. Grund für seine Inhaftierung war seine Betätigung für die SPD. 1933 war Wilhelm Kohlen Stadtverordneter der SPD im Rat der Stadt Stolberg und Abgeordneter im Kreistag des Kreises Aachen. Gleichzeitig führte er die lokale Gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Nach seiner Haft konnte er bis 1939 sein Handelsunternehmen unter Beobachtung weiterführen. 1939 bis 1944 gründete er ein kleines Transportunternehmen, nicht zuletzt, um sich unauffälliger in der Region Aachen bewegen zu können. Wilhelm Kohlen führte häufig illegale Flugblätter und Tarnschriften aus dem belgisch/niederländischen Raum nach Deutschland ein. 1944 wurde er bei dieser Arbeit ertappt und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verbracht. Hier wurde er 1945 von der amerikanischen Armee befreit. 1948 konnte er sein Transportunternehmen wieder gründen und führte dies bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1954 weiter. 1945 bis 1948 war Wilhelm Kohlen in der damaligen Gemeinde Gressenich als Bürgermeister und Gemeindedirektor aktiv. Politisch wurde der Regierungsbezirk Aachen am 20. Mai 1945 der englischen Besatzungszone zugeteilt. Wilhelm Kohlen wurde am 1. August 1945 Bürgermeister der Gemeinde (). Am 13. September 1946 wurden alle Bürgermeister und Amtsträger ihrer Ämter enthoben, um eine demokratische Neuordnung in den Verwaltungen einzuführen. Die Verwaltungschefs waren ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Bürgermeister, sondern Stadt- oder Gemeindedirektoren.
Am 4 Aug 1947 kam es zwischen Gemeindedirektor Kohlen, Rentmeister Jansen und Bürgermeister Stanen zu einer Verhandlung vor der Militärregierung in Aachen. Oberst Soutten und Major Laice und Dr. Korn waren zugegend. Grund waren die Unstimmigkeiten zwischen Bürgermeister und dem Gemeinderat, der sich in Verwaltungsangelegenheiten einmischte. Bürgermeister Staner gab u.a. bekannt, daß ihm am gleichen Tag ein von elf Ratsmitgliedern unterzeichneter Antrag überreicht worden sei, den Gemeindedirektor Kohlen ab sofort zu beurlauben und un zum 30 Sep 1947 zu kündigen. Gemeindedirektor Kohlen schied dann per 30 Sep 1947 aus den Diensten der Gemeinde Gressenich aus.
Am 4 Feb 1949 wird Kohlen als Bürgermeister der Gemeinde Gressenich geführt.
Dem Kreistag des damaligen Landkreises Aachen gehörte er vom 9. Dezember 1949 bis zum 27. Oktober 1956 an. Hier lag Kohlens Arbeitsschwerpunkt im Finanzausschuss und im Wohnungsbau. In der Zeit vom 9. Dezember 1949 bis zum 27. November 1952 war er hier als Landrat tätig. Wilhelm Kohlen verstarb am 31. Oktober 1964. Er hinterließ seine Frau und ein Kind.
Politisch wurde der Regierungsbezirk Aachen am 20 Mai 1945 der englischen Besatzungszone zugeteilt. Wilhelm Kohlen wurde am 1 Aug 1945 Bürgermeister der Gemeinde. Am 13 Sep 1946 wurde alle Bürgermeister und Amtsträger ihrer Ämter enthoben, um eine demokratische Neuordnung in den Verwaltungen einzuführen. Nikolaus Staner wurde als Nachfolger von Wilhelm Kohlen zum Bürgermeister der Gemeinde Gressenich gewählt. Die Verwaltungschefs war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Bürgermeister, sondern Stadt- oder Gemeindedirektoren, so auch Wilhelm Kohlen in der Gemeinde Gressenich.
Rückblickend sind vor allem die die raumpolitischen Bestrebungen des Landkreises seit Beginn der 50er Jahre als sehr vorausschauend und mutig zu bezeichnen. 1949/50 schlug der Landkreis vor, den Wiederaufbau des Aachener Wirtschaftsraumes durch einen „Wurmsiedlungsverband", der den weiteren Aachener Wirtschaftsraum umfassen sollte, planen und in bestimmten Zügen verwirklichen zu lassen. Diese Idee hatte den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk zum Vorbild, der als übergreifende kommunale Organisation festgelegte Aufgaben u. a. im Bereich der Raumordnung und des Städtebaus übernahm, und seit dem Jahr 2004 die Bezeichnung Regionalverband Ruhr führt. Diese fortschrittliche Idee scheiterte leider aufgrund des Widerstandes der Stadt Aachen. Eine weitere Initiative, die die Bündelung und bessere Koordination der Verkehrsplanungen und Verkehrsträger im Regierungsbezirk Aachen zum Ziel hatte, konnte 1950 verwirklicht werden. Am 5. Mai 1950 kam es zur Gründung des „Verkehrsverbundes West e. V." der sich unter anderem „die Förderung aller am Verkehr und der Wirtschaft […] beteiligten Einrichtungen zum Zwecke der rationellsten verkehrsmäßigen Erschließung des Aachener Raumes" als Aufgabe gesetzt hatte. Da die Arbeiten des Verbandes stagnierten, musste der Verkehrsverband 1967 seine Tätigkeiten einstellen und wurde 1973 schließlich aufgelöst. Im Jahr 1950 wurde der Kreisdirektor neben seinem Hauptamt mit der Gesch.ftsführung des Wasserwerkes des Landkreises Aachen beauftragt. Bei der Kulturpolitik beschränkte sich der Kreis aus verschiedenen Gründen auf einige Kernthemen, dazu gehörten seit 1951 die Unterhaltung eines kleinen Theaters, die P!ege denkmalwerter Bauten sowie die Förderung des Männergesangs. Das „kleine Theater" war das bis 1951 privatgeführte Aachener „Theater im Zimmer", das der Landkreis 1951 gemeinsam mit einigen Industrieunternehmen übernahm und zu einer „Kreiswanderbühne" weiterentwickelte. 1962 wurde das Theater in Grenzlandtheater umbenannt, bis 1966 sicherte sich der Landkreis alle Anteile.1951 wurde die Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft des Landkreises Aachen GmbH gegründet, der alle kreisangehörigen Städte- und Gemeinden außer der Gemeinde Merkstein angehörten. Ebenfalls im Jahr 1951 traten die ersten Spannungen zwischen der Stadt Aachen und dem Landkreis nach dem 2. Weltkrieg auf, die bereits in den 20er und 30er Jahren zu Tage getreten waren und die sich bis zur kommunalen Neugliederung 1971 wie ein roter Faden durch die Geschichte ziehen. Hier ging es um die räumliche Entwicklung in der Aachener Region. Der Landkreis hätte sich gewünscht, dass die Stadt Aachen gemeinsam mit dem Landkreis einen „Aachener Wirtschaftsraum" aufgebaut hätte und eine neue Lösung zur Entspannung der Raumfrage der Stadt Aachen gefunden worden wäre. Stattdessen verlangte die Stadt Aachen 1951 nach Eingemeindungen einzelner eigenständiger Randgemeinden des Landkreises wie beispielsweise der Gemeinde Laurensberg. Die Stadt erklärte, dass sie die militärischen Übungsplätze, Schrebergärten sowie Mülldeponien ins Kreisgebiet verlegen müsste, wenn nicht ihr Gebiet durch Eingemeindungen erweitert würde. Der Kreistag trat den Eingemeindungsbekundungen der Stadt in seiner Sitzung vom 31. Juli 1951 entschieden entgegen. Trotz dieser Enttäuschung verfolgte der Landkreis weiterhin gesamträumliche Gedanken. 1952 musste über Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des Trinkwassers neu beraten werden. Wiederum gegen Wiederstände aus dem Aachener Stadtkreis aber auch aus Stolberg setzte sich der Landkreis durch und verband die Düren-Jülicher Wasserwirtschaft mit den Anlagen des Wasserwerkes des Landkreises zu einem regionalen Wasserverband. [2, 3, 4] |
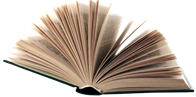

 [1]
[1]  [3]
[3] 
 gest. 17 Aug 1969, Stolberg, (DE)
gest. 17 Aug 1969, Stolberg, (DE)  (Alter 70 Jahre)
(Alter 70 Jahre)  gest. 25 Mrz 2010 (Alter 87 Jahre)
gest. 25 Mrz 2010 (Alter 87 Jahre)
