| Notizen |
- Ludwig Wolff ging 1949 ein großes Wagnis ein. Er entschied sich, in Delmenhorst einen eigenen Maschinenbaubetrieb zu gründen Es gehörten schon Mut und Selbstvertrauen dazu, sich knapp ein Jahr nach der Währungsreform 1948 selbständig zu machen. Vom Wirtschaftswunder war damals noch nirgendwo die Rede. Doch so war Wolff. Er war grenzenlos optimistisch und verlor nie den Glauben an eine bessere Zukunft. Das Licht der Welt erblickte er am 25. Mai 1913 in Schevenhütte, einem kleinen Ort im Kreis Aachen. Seine Eltern waren Peter Wolff, und dessen Ehefrau Katharina (geborene Lothmann). Das Ehepaar Wolff hatte elf Kinder. Ludwig war der siebte Sprössling der Familie. In Schevenhütte besuchte er von 1919 bis 1927 die Volksschule. Er war ein guter Schüler und fand nach dem erfdgreichen Abschluss eine Lehrstelle als Huf- und Wagenschmied. Nach drei Lehrjahren war er Geselle. Doch eine Arbeitsstelle im Schmiedehandwerk fand er damals, im Jahr 1930, nicht. Es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise und der damit verbundenen Massenarbeitslosigkeit. Er hatte jedoch Glück und fand 1931 eine Stelle bei der Deutschen Reichspost in seinem Heimatort. Seine Schwester arbeitete ebenfalls dort. Doch ausgefüllt hat Wolff die Arbeit nicht. Ab 1935-1936 war der Flugzeugbauer Dornier auf der Suche nach Fachkräften. Als Wolff davon erfuhr, bewarb er sich bei der Niederlassung des Unternehmens in Wismar. Nach einem Test, den der intelligente junge Mann mit Leichtigkeit bestand, wurde er vom 1. August 1936 bis zum 31. April1 938 zum Flugzeugmechaniker umgeschult. 1938 wechselte Wolff seinen Arbeitsplatz, fing bei der Firma Focke-Wulf in Bremen als Flugzeugmechaniker an. In der Hansestadt lernte er auch bald seine zukünftige Frau kennen. Doch der bevorstehende Zweite Weltkrieg beendete vorerst alle beruflichen und familiären Pläne des damals 35-Jahrigen. Am 30. Januar 1939 wurde er zum Luftwaffennachrichten-Regiment in Braunschweig- Querum einberufen. Dort erhielt er bis zum 30. April 1939 eine Ausbildung alsFunker. Wolff blieb bei der Wehrmacht und erlebte den Beginn des Zweiten Weltkrieges somit hautnah mit. Zwei Wochen nach Ausbruch der Feindseeligkeiten wurde Wolff schwer verletzt. Bis zum Dezember 1940 lag er in Lübeck im Lazarett. Seine Verletzungen waren so gravierend, dass ein weiterer Einsatz an der Front nicht mehr denkbar war. Die Wehrmacht musste ihn 1940 entlassen. Seine Verlobte stand ihn in der schweren Zeit stets zur Seite und vermittelte ihm Zuversicht. Noch im gleichen Jahr, am 9. November 1940, traten Ludwig und Anna-Maria Wüstefeld in Bremen vor den Traualtar. Das junge Ehepaar bezog schon bald eine Wohnung in Bremen-Rönnebeck. Wolff fand als Schwerbeschädigter vom 1. Januar 1941 bis zum Kriegsende Arbeit als Obertruppmeister beim Reichsluftschutzbund Ortsgruppe Bremen-West. Nach demKriegwar Wolffbei der amerikanischen Besatzern als technischer Angestellter beschäftigt. Sein Arbeitsplatz war die Roland-Kaserne in Bremen-Grohn. Hier war er bis zum 15. Februar 1947 tätig. Am 11. September 1945 kam der erste Sohn des Ehepaar Wolffs zur Welt. Er bekam den Vornamen des Vaters, Ludwig. Von Juni 1947 bis Juni 1949 betrieb Ludwig Wolff mit seinem Bruder Heinrich in Delmenhorst eine kleine Werkstatt. Die befand sich am Brendelweg und stellte Haushaltswaagen und ähnliche Gegenstände für den täglichen Gebrauch her. Den Weg von seinem Wohnung von Bremen nach Delmmiiorst legte er täglich mit einem Hilfsmotorrad zurück. 1948 bestand Wolff seine Prüfung als Maschinenbaumeister. Wie schon eingangs erwkhnt, wagte Wolff 1949 den Sprung in die Selbständigkeit. Er gründete die Firma L. Wolff Maschinenbau. Seine erste Werkstatt befand sich in Adelheide, in der Nähe der Bäckerei Hülsemeier. Offenbar hatte er eine Marktlücke entdeckt. Seine Erzeugnisse verkauften sich ausgesprochen gut. Das Unternehmen entwickelte sich so erfolgreich, dass die Werkstatt den Anforderungen schon bald nicht mehr genügte. Familie Wolff, die schon seit 1948 in Delmenhorst wohnte, spürte schnell eine zu verpachtende Werkstatt an der Schanzenstraße auf. Dort befand sich ehemals die Fahrzeugreparaturwerkstatt Imhoff. Im Jahr 1950 zog der L. Wolff Maschinenbau dort ein. Hier standen dem erfolgreichen Jungunternehmer deutlich gröRere Produktionsräume zur Verfügung. Doch Sparsamkeit und unermüdlicher Fleiß waren auch weiterhin unabdingbar. Anna- Mariu Woiff, die bei den Margarinewerken Arbeit fand, steckte einen Großteil ihres Verdienstes in das Familienunternehmen. Zugleich half sie ihrem Ehemann nach Feierabend noch häufig dabei, alle anstehenden Termine einzuhalten. Wolff, dem anfangs noch so manche Maschine für die Werkstatt fehlte, räumte nebenbei in Bremen Trümmer beiseite. Dabei fand er durch Zufall eine alte Drehmaschine. Mit einem Pferdegespann holte er das gute Stück in seine Werkstatt. Nachdem er die Maschine wieder in Schuss gebracht hatte, konnte das Unternehmen wesentlich effektiver arbeiten. Weil das Glück bekanntlich auf der Seite des Tüchtigen ist, ging es mit dem Unternehmen stetig aufwärts. 1955 konnte Wolff die bislang nur gepachtete Werkstatt erwerben und die Werkhalle erweitern. Der Betrieb stellte in jener Zeit Messund Mischapparate sowie einbaufertige Maschinenteile für den allgemeinen Maschinenbau her. Im Jahre 1971 wurde der Neubau einer Montage- und Verladehalle fertiggestellt. Das ermöglichte jetzt die Umstellung der Produktion auf Drehkräne und Winden für den Schiffbau sowie auf die Herstellung von Spezialmaschinen Kir die Astbest-Zementindustrie. Diese Maschinen waren eine eigene Konstruktion der Firma, die Wolff mit seinen kreativen Ideen ständig verbesserte. Besonderen Wert legte Wolff auf die Lehrlingsausbildung. Viele seiner Auszubildenden blieben dauerhaft oder zumindest einige Jahre im Unternehmen. Dadurch standen Wolff stets gut ausgebildete Mitarbeiter zur Seite, die alle anfallenden Arbeiten ausführen und selbst größere Probleme lösen konnten. Auch Sohn Ludwig absolvierte seine Lehrjahre ab 1960 im väterlichen Betrieb. 1970 legte er seine Meisterprüfung ab und stand ab sofort seinem Vater bei der Betriebsführung zur Seite. 1973 gründete Familie Wolff eine Kommanditgesellschaft. Ein Jahr später bezog die Firma ein neues Bürogebâude. Wolff und seine Ehefrau konnten voller Genugtuung feststelIen: .,Wir haben es so gewollt und uns durchgesetzt." Zwei Jahre nach dem 65. Geburtstag des Firmenchefs, also 1978, wurde der Betrieb in eine GmbH umgewandelt und Sohn Ludwig Geschäftsführer der L.-Wolff-Maschinenfabrik. Wolff senior blieb „seiner Firma" weiter treu. Er richtete sich dort eine kleine, private Werkstatt ein und war bis an sein Lebensende im Februar 1998 dort ständig präsent. Ludwigs Ehefrau Anna-Maria wurde 82 Jahre alt. Sie starb zwei Jahre vor ihm, im November 1996.
|
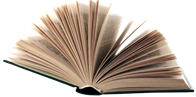


 [1]
[1]  gest. 16 Dez 1951, Nideggener Strasse 2, Schevenhütte, (DE)
gest. 16 Dez 1951, Nideggener Strasse 2, Schevenhütte, (DE)  (Alter 75 Jahre)
(Alter 75 Jahre)  gest. 4 Mrz 1950, Nideggener Strasse 2, Schevenhütte, (DE)
gest. 4 Mrz 1950, Nideggener Strasse 2, Schevenhütte, (DE)  (Alter 73 Jahre)
(Alter 73 Jahre)  [2]
[2] 