| Notizen |
- Das alte Bankhaus J. D. Herstatt
Die Geschichte des Hauses Herstatt beginnt in Köln 1727. In diesem Jahr gründete Isaak Herstatt (1697 - 1761), Nachkomme einer hundert Jahre früher aus dem flandrischen Valenciennes vertriebenen Hugenottenfamilie, in Köln eine Seidenweberei. Aus diesem Fabrikgeschäft entwickelte sich ein florierendes Handelshaus, das seit 1782 vom ältesten Sohn Johann David Herstatt unter dem Firmennamen J.D. Herstatt weitergeführt wurde und bereits im 18. Jahrhundert bedeutende bankgeschäftliche Aufgaben übernahm. Als Bankhaus erlebte J. D. Herstatt in der Folgezeit einen großartigen Aufstieg. Während vier Generationen wurde die Führung der Bank nach dem Tode des Vaters auf den jeweils ältesten Sohn übertragen.
So prägten die Geschichte des Hauses nacheinander
Johann David Herstatt * 1740 +1809
Kommerzienrat Friedrich Peter Herstatt *1775 +1851
Geheim. Kommerzienrat Johann David Herstatt * 1805 + 1879
Friedrich Johann David Herstatt *1831 + 1888
Friedrich Johann David Herstatt, der unerwartet im Alter von 56 Jahren starb, hinterließ nur einen erst dreiviertel Jahr alten Sohn mit dem alten Familiennamen Johann David. Da die Herstatt-Söhne in den verantwortungsvollen Beruf des Privatbankiers stets durch die Väter eingeführt wurden, bis sie das Bankgeschäft in eigenem Namen und auf eigene Rechnung übernehmen konnten, wurde 1888 in der Familie der Entschluß gefaßt, das Bankhaus J. D. Herstatt auf das verwandtschaftlich nahestehende und befreundete Bankhaus J.H. Stein zu übertragen. Der in vier Generationen zu hohem Ansehen gekommene Name J. D. Herstatt fiel so vorübergehend der Treue zu einem Familien- und Geschäftsprinzip zum Opfer. Wenn auch der Firmenname erlosch, das Traditionsbewußtsein der Bankiersfamilie Herstatt war damit keineswegs verlorengegangen. Auch der junge Johann David, genannt Iwan Herstatt, strebte wieder eine Verwirklichung der Tradition an; sie blieb ihm jedoch versagt, nicht zuletzt infolge der Krisenzeiten in den zwanziger und dreißiger ]ahren dieses Jahrhunderts. Als sein Sohn Iwan-D. Herstatt nach fast 25jähriger Tätigkeit in Großbanken Ende 1955 die jetzige Privatbank I. D. Herstatt K. G. a. A. gründete, knüpfte er bewußt an die Geschichte des alten Hauses J. D. Herstatt an.
Das Außergewöhnliche dieser Neugründung wird erst deutlich, wenn man das Schicksal von Familientraditionen verfolgt. Selten überdauern sie ein Jahrhundert, sei es, sie bilden sich im Bereich der Kunst oder der Wissenschaften, oder sie gelangen auf dem Gebiet wirtschaftlichen Tuns zur Blüte. Meist fehlen in der Generationsfolge, wenn diese nicht jäh abbricht, die Kräfte zur Erneuerung und Verwandlung, durch die sich allein bedeutende Traditionen im Wandel der Zeiten behaupten kömlen.
Die Geschichte des Bankwesens verzeichnet bis in die Gegenwart nur wenige Namen von Familien, in denen seit mindestens fünf Generationen die Berufung zum Privatbankier von seiner ältesten bis zur modernsten Prägung lebendig geblieben ist. In Europa bestehen kaum mehr als ein Dutzend Privatbanken von Bedeutung, die im 18. Jahrhundert oder früher entstanden sind und heute noch von Nachkommen der Gründer maßgeblich geleitet werden.Wollte man das neue Bankhaus I. D. Herstatt in diese Reihe der ältesten privaten Finanzinstitute eingliedern, so wäre dies durch die Kontinuität und Stärke des Traditionsbewußtseins der Bankiersfamilie Herstatt gerechtfertigt.
Entstehung und Entfaltung der Kräfte, die den Geschlechtern der Familie Herstatt ihre Lebens aufgabe als eigenständige Bankherren und damit eine Berufung zu unbedingter Selbstverantwortung zuwiesen, lassen sich nicht mehr vollständig nachzeichnen, da fast alles primäre Quellenmaterial, wie z. B. die Geschäftsbücher und Korrespondenz des alten Bankhauses
sowie private Briefe und Aufzeichnungen, verlorengegangen ist. Andere historische Darstellungen und Überlieferungen gestatten es dennoch, ein perspektivenreiches und farbenkräftiges Bild zu entwerfen.
Vier Grundfaktoren erhellen das Verständnis für die Anfänge und den Werdegang des Kölner Bankiergewerbes, im besonderen des Bankhauses Herstatt:
Die dominierenden Charaktereigenschaften der Gründerfamilie Herstatt vermochten sich mit seltener Konstanz in den Generationen durchzusetzen. J.Nicke stellte in seiner 1885 erschienenen Chronik der Familie Herstatt,schlichte Einfachheit, emsiges, rastloses Streben, eisernen Fleiß und unantastbare Rechtlichkeit bei den Männern des Hauses fest. Hierin dürfte die über ein Jahrhundert währende erfolgreiche Führung der alten Herstatt-Bank begründet sein, denn diese Grundeigenschaften statten den Bankier mit einem nicht abwertbaren Eigenkapital aus, das sich sicher verzinst, weil es Vertrauen schafft.
Als zweiter Faktor kann wohl die geschichtsbildende Macht des historischen Bodens der Stadt Köln angesehen werden. Hier ließen sich die protestantischen Herstatts um 1720 nieder, 70 Jahre vor dem Ende der reichsstädtischen Zeit. Sie fanden trotz anfänglich starker Widerstände nach und nach die volle Entfaltung ihrer Talente. Gemeinsam mit den schon länger an-
sässigen katholischen Schaaffhausens und den 70 bzw. 80 ]ahre später zugewanderten protestantischen Steins aus Mannheim und der jüdischen Familie Oppenheim aus Bonn begründeten sie das Kölner Privatbankgewerbe. Diesem fiel vom zweiten Viertel des 19. ]ahrhunderts an eine führende Rolle nicht nur für die Industrialisierung der deutschen Volkswirtschaft, sondern auch im Entwicklungsprozeß des europäischen Bankwesens zu. Köln, das bereits im frühen Mittelalter Handels- und Finanzzentrum des nördlich der Alpen gelegenen Teils Europas gewesen war, wurde für die vier Bankiersfamilien und später für die Familien Seydlitz und Merkens, Camphausen, Deichmann und Eltzbacher fruchtbarster Boden. Diese Anziehungskraft besaßen damals z. B. auch Frankfurt für die Rothschilds, Bethmanns, Grunelius', Haucks und Metzlers, und später Paris für die Haute Banque, die Familien Hottinger, Mallet, Verne, de Neuflize, Lazard und Worms, die teilweise ihre erste Entfaltung zuvor an dem bedeutsamen Genfer Platz gefunden hatten.
Die Dynamik der Entwicklung wird durch den dritten Faktor begreiflich: die schöpferische Vitalität, mit der die Kölner Bankiers den großen wirtschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit begegneten und die wechselvollen Ansprüche der Wirtschaftsgeschichte beantworteten. Schon im 18. Jahrhundert war durch ihre unbeugsame konfessionelle Haltung ihr Behauptungswille, aber auch ihr Streben, sich durch hervorragende Leistungen anzupassen, gewachsen. Um so mehr verfügten sie später über die vitalen Fähigkeiten, den Wandel vom Wechselbankier kleineren Formats zum Universalbankier zu vollziehen und dadurch die industrielle Revolution zu fördern. Schließlich war kennzeichnend für diese Zeit des über die Landesgrenzen wirkenden Durchbruchs zum Bankwesen im modernen Sinne die Solidarität des Kölner Bankierstandes. Sie blieb bis in die Krisenjahre der Gründerzeit erhalten und ermöglichte erst die zukunftweisen den Gründungen und Finanzierungen von Versicherungsunternehmen, Eisenbahn- und
Schiffahrtgesellschaften, von Aktiengesellschaften in der Bergbau- und Hüttenindustrie, im Maschinenbau und in der chemischen Industrie sowie die Gründungen von Aktienbanken, auf die das heutige Großbankwesen unmittelbar zurückgeht. Das Kölner Bankenkonsortium hatte im zweiten und dritten Viertel des vorigen Jahrhunderts für die in- und ausländische Industriefinanzierung eine ähnliche Bedeutung wie das Rothschildkonsortium für die europäischen Staatsfinanzen. Es sei schon jetzt bemerkt, daß die Herstatts, die in der ersten Zeit unter den Kölner Instituten die größere Kapitalkraft besaßen und vorübergehend eine Führungsrolle
innehatten, bei allen gemeinsamen Neugründungen, Emissionen, Fusionen und Sanierungen besonders abwägend waren. Sie zogen gegenüber den stürmischen, stets von neuen Ideen und Plänen beherrschten Konsorten die Risiken nüchtern in Rechnung. Diese abwägende Art war Ausdruck einer äußerst soliden Geschäftshandhabung, die später geradezu sprichwörtlich werden sollte. Dauerhaftes Ansehen einer Privatbank bildet sich nicht allein im vagen Raum persönlicher Sympathien, gesellschaftlichen Prestiges oder gar architektonischer Repräsenta- tion, auch nicht durch wachsende Kapital- und Bilanzzahlen; entscheidend ist die Beharrlichkeit, mit der sich solide Geschäftspraxis bei den Inhabern und Leitern einer Bank Generationen hindurch zu halten vermag. Daß eine konstante Solidität nicht gleichzusetzen ist mit Konservativismus, wie meist angenommen wird, sondern praktische Fortschrittlichkeit sogar bedingt, sei später dargelegt.
Die Vorgeschichte des Bankhauses Herstatt zeigt bereits Merkmale kaufmämischen Unternehmertums. Nach handschriftlichen Aufzeichnungen war der Stammvater Hubert Herstatt (1596-1678) in Eschweiler bei Aachen als fabriquant wohnhaft gewesen. Er hatte als Reformierter seine Heimatstadt, das damals niederländische, heute französische Valenciennes, verlassen müssen und fand nach einer Zwischenstation im Kanton Limburg vermutlich zunächst in Aachen Aufnahme. Um jene Zeit kam eine größere Zahl von Reformierten in die damalige Freie Reichsstadt Aachen. Sie erlangten sogar im Rate der Stadt ein solches Übergewicht, daß sie sich vorübergehend des Regiments bemächtigten. Die Achterklärung des Kaisers wurde 1614 vom spanischen General Spinola mit großer Strenge vollstreckt, so daß viele Reformierte in das Herzogtum Jülich flüchteten, wo sich kleinere Reformierten- Gemeinden halten konnten. J. Nicke, dessen Darstellung in der erwähnten Familienchronik wir hier folgen, stellt fest, daß die Familie Herstatt in Eschweiler die ersehnte Ruhe fand. Nach der Vermählung Hubert Herstatts mit Maria Remeys aus Aachen verblieben die meisten Nachkommen bis in die dritte Generation in Eschweiler. Kennzeichnend für diese Zeit ist der große Ernst, mit dem die Angehörigen des Hauses Herstatt zu ihrem Bekenntnis standen. Sie haben lange Zeit hindurch in der Geschichte der Reformierten in Eschweiler eine hervorragende Stelle eingenommen.
Das bürgerliche Ansehen und die geschäftliche Stellung der Familie Herstatt müssen in dieser Zeit schon bedeutend gewesen sein. Dies beweist auch die Tatsache, daß sich die Söhne und Töchter durch Heirat mit angesehenen reformierten Familien der näheren und weiteren Umgebung verbinden konnten. Es seien hier nur genannt die Familien Schombarth und Nierstraß aus Eschweiler, Peltzer aus Stolberg, die aus Zürich stammende, heute noch in Düren lebende Familie Hoesch, Steinberg aus Düsseldorf und Welter aus Köln.
Die Vermählung der Enkelin des Stammvaters, der Katharina Mintha Herstatt, im Jahre 1713 mit dem Kaufmann und Fabrikanten Peter David Welter in Köln sollte für die Zukunft der Herstatts eine entscheidende Bedeutung erlangen. Peter David Welter nahm sich noch im gleichen ]ahr des sechzehnjährigen Schwagers Isaak Herstatt an, der Stammvater der allein noch blühenden Kölner Linie wurde. Nachdem Isaak 1712 in Elberfeld Französisch gelernt hatte, ging er auf Empfehlung seines Schwagers in den nächsten sechs Jahren nach Halle und Frankfurt und erhielt in angesehenen Handelshäusern eine vielseitige kaufmännische Ausbildung.
Diese Zeit war für Isaak Herstatt wohl sehr entscheidend, denn damals fühlte sich der Lehrherr noch verantwortlich für die Persönlichkeitsbildung der ihm anvertrauten jungen Menschen. Anfang 1720 kehrte Isaak zurück in seine niederrheinische Heimat und trat in das Geschäft seines Schwagers in Köln ein. Bereits drei Jahre später wurde er Kompagnon des Welterschen Geschäfts. Durch überragende Tüchtigkeit gelang es ihm, bis 1727 die Voraussetzungen für die Gründung einer eigenen Seiden- und Florettbandfabrik zu schaffen.
Für einen nichtkatholischen Fremden war die Gründung eines selbständigen Geschäftes in Köln mit großen Schwierigkeiten verbunden. Die Verfassung der Freien Reichsstadt Köln ging zurück auf eine Zeit, in der die katholische Religion die allein herrschende war. Die Grundlagen bildeten der sogenannte Verbundbrief, der im Jahre 1396 nach der blutigen Erhebung des Volkes gegen das herrschende Patriziat der Aristokraten den Zünften die größte Macht einräumte und damit eine der ersten demokratischen Stadtverfassungen in Europa schaffte, und der Transfixbrief von 1513, durch den eine Günstlingswirtschaft des Rates vermieden werden sollte und die Stellung der Zünfte und Gaffeln wesentlich verstärkt wurde.
Zwar hatte vor allem der Transfixbrief die Unantastbarkeit der persönlichen Freiheit garantiert, jedoch blieb sie in der nachreformatorischen Zeit praktisch beschränkt auf die Katholiken der Stadt. Der tolerante Geist, der sich noch lange nach der Römerzeit, als in Köln neben römischen auch ägyptische, griechische, persische und irische Gottheiten verehrt wurden,
wohl bis in die fränkische Zeit hinein halten konnte, wurde erst in der Periode der Aufklärung allmählich wieder lebendig. Bis zur Besetzung Kölns durch die französische Occupationsarmee bzw. noch wenige Jahre danach war die Erlangung des Bürgerrechts und die Aufnahme in eine Zunft an die Bedingung geknüpft, daß der Betreffende sich zum katholischen Glauben bekenne. Ferner konnten Protestanten und Juden in Köln keine Immobilien erwerben. Angesichts dieser verfassungsmäßigen Beschränkung ist es überraschend, daß Isaak Herstatt die Genehmigung zur Errichtung einer eigenen Fabrik sowie eines eigenen Handelshauses er-
halten hat. Es gibt aus dieser Zeit mehrere Beispiele für die Duldung Reformierter in Köln, wo das Wirtschaftsleben nicht mehr so florierte wie in früheren Zeiten. Der Zuzug von vertriebenen Protestanten, deren Gewerbefleiß meist vorbildlich war, kam selbst den Zünften nicht ungelegen.
Uber die Entwicklung der Seiden- und Florettbandfabrik ist kaum etwas bekannt, jedoch muß der nach dem Verlagssystem organisierte Betrieb einen für die damalige Zeit bemerkens werten Umfang angenommen haben, denn es wird berichtet, daß Isaak Herstatt die Messen von Leipzig, Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder und Braunschweig regelmäßig mit größeren Posten von Florett- und Seidenbändern beschickte. Er beteiligte sich auch an Lieferungen für die preußische Armee.
Im Gründungsjahr seiner Firma verheiratete sich Isaak Herstatt mit Gertrud Lomberg aus dem rechtsrheinischen Langenberg. Zunächst wohnten sie im Hause Peter David Welters, das auf der Bach, später Blaubach Nr. 30, lag. Die Geschäftsräume verlegte Isaak Herstatt schon bald nach der Hohe Pforte Nr. 9, wohin er auch später mit seiner Familie übersiedelte.
Bis 1749 gebar seine Frau Gertrud dreizehn Kinder, darunter neun Söhne, von denen nur die vier jüngsten, Johann David (1740-1809), Johann Jakob (1743 1811), Christoph (1744-1816) und Johann Peter (1749-1822) den Vater überlebten. Nach dem Tode des Vaters 1761, dem die Mutter ein Jahr später folgte, führte der 20jährige Johann David unter Mitwirkung seines
wenig jüngeren Bruders Johann Jakob den Betrieb weiter. Der Firmenname Isaak Herstatt wurde 1779 in Gebr. Herstatt umgewandelt. Ab 1782 aber leitete dann Johann David Herstatt die Firma allein und gab ihr den Namen J. D. Herstatt, der unverändert beibehalten worden ist.
A. Krüger, dessen 1925 erschienenes Buch Das Kölner Bankiergewerbe vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1875 als einzige Quelle für die weitere Entwicklung des Hauses J. D. Herstatt zur Verfügung steht, berichtet über die Seidenfabrik, die in den siebziger Jahren ihre höchste Blüte erreichte: Sie beschäftigte damals nicht weniger als 30 Meister des Posamentieramtes
mit über 200 Webstühlen. Dieser Betriebsumfang ließ sich jedoch im folgenden Jahrzehnt nicht mehr aufrecht erhalten. Einmal führte das auf Entwicklungshemmnisse zurück, deren Wurzeln in der konservativen Einstellung der die reichsstädtische Wirtschaftspolitik bestim menden Zünfte, insbesondere in der schroffen Ablehnung produktionstechnischer Neuerungen, wodurch die Wettbewerbskraft der heimischen Unternehmungen untergraben wurde, zu suchen waren. Außerdem hatten die Herstatts immer härter unter Anfeindungen und Schikanen sowohl seitens katholischer Händler und Fabrikanten als auch seitens des Posamentieramtes zu leiden.< So kam es, daß Johann David Herstatt, als er den Betrieb für alleinige Rechnung und in eigenem Namen weiterführte, mit kaum mehr als 100 Webstühlen begann. Mit unternehmerischer Phantasie wußte er dieser Situation zu begegnen. Er erweiterte unter dem Eindruck der von Jahr zu Jahr ungünstigeren Lage der Bandfabrik seinen Wirkungskreis
durch planmäßige Übernahme bankgeschäftlicher Funktionen. Mittel hierfür setzte der zu nehmende Produktionsrückgang der Fabrik reichlich frei, da der in hochwertigem Rohstoff festzulegende Teil des Betriebskapitals sich entsprechend verringerte. Es konnte ferner von vornherein mit einem entwicklungsfähigen, in den verschiedensten Wirtschaftszweigen wurzelnden Kundenstamm gerechnet werden, war doch das Haus nach und nach in enge Fühlung zu einen großen Teil angesehener Industrie- und Kaufmannsgeschlechter getreten. Dazu gehörten Namen wie von der Leyen, Heidweiler, von den Westen, Schleichel, von Asten, Peill, Hoesch, Schombarth, Nierstraß, Peltzer, Schöller und Brügelmann. Daß der neue Geschäftszweig rasch an Bedeutung gewann, bekräftigte die Tatsache, daß J. D. Herstatt sowohl in einem Ratsprotokoll vom 27. Januar 1792 als auch in Ratsakten aus dem Jahre 1793 ausdrücklich als Bankier bezeichnet wird.
Die Herstellung von Seiden- und Florettband wurde noch in bescheidenem Ausmaß weiterhin beibehalten. Erst in der französischen Zeit, als einer Umstellung auf den französischen Markt der Wettbewerb der hochentwickelten Seidenindustrie von Lyon, Valenciennes und anderen Städten entgegentrat und zudem unverhältnismäßig hohe Zollabgaben auf die benötigten Rohstoffe produktionserschwerend wirkten, schritt man zum endgültigen Abbau des Fabrikationsbetriebes: die letzten neun noch laufenden Webstühle wurden 1812 stillgelegt.
Damit war jedoch nicht der Übergang zu ungeteilter Einstellung auf bankgeschäftliche Wirksamkeit vollzogen, sondern man verband diese in Übereinstimmung mit der allgemeinen Tendenz mit Warenspedition und -kommission; eine Kombination, die für das Haus erst mit dem Ende der Reichsfreiheit Kölns und der alten wirtschaftlichen und sozialen Bindungen ermöglicht wurde, die dann aber, wie u. a. aus überlieferten Schiffsladelisten hervorgeht, noch bis weit in die 1830er Jahre hinein fortbestanden hat. (Krüger)
Die Umstellung auf eine überwiegend bankgeschäftliche Tätigkeit setzte eine zielstrebige, zukunftsgewandte Persönlichkeit mit großem Anpassungsvermögen voraus. Über die Lehrjahre des jungen Johann David ist nichts bekannt. Fest steht nur, daß Johann David beim Eintritt in das dritte Lebensjahrzehnt durch den Tod seines Vaters gezwungen war, die Geschicke des Hauses zu übernehmen. Sein jüngerer Bruder Johann Jakob, der später seine eigenen Wege ging und eine Weinhandlung errichtete, mag ihm tatkräftig zur Seite gestanden haben. Die Verantwortung für das stark expandierende Fabrikgeschäft jedoch lastete auf seinen Schultern.
Die väterliche Führung bei der Heranbildung zum selbstverantwortlichen Kaufmann und Fabrikanten war nur von kurzer Dauer; sicherlich aber hatte Isaak, der längst über den für einen aufstrebenden Unternehmer beengten Wirkungskreis seiner Heinlatstadt Eschweiler hinausgewachsen war und sich in die weltoffene Kaufmannstradition der Rheinmetropole hineingefunden hatte, seinem Sohn solide Grundlagen für seine Lebensaufgabe vermitteln können.
Als ein Zeichen für das Ansehen, das Johann David offenbar schon in frühen Jahren genoß, mag die 1764 erfolgte Vermählung mit Adelaide von der Leyen aus der einfußreichen und damals führenden rheinischen Textilfabrikantenfamilie aus Krefeld gewertet werden. Mit der Familie von der Leyen bestanden schon zu Lebzeiten des Vaters enge geschäftliche Beziehungen, die sich durch diese und weitere Heiraten zwischen den beiden Häusern noch festigten. Es ist anzunehmen, daß der junge Fabrikant Herstatt zuweilen in Krefeld im Hause von der Leyen, in dem ebenfalls ein ausgeprägter Familiensnn herrschte, geschäftlichen Rat einholen
konnte. Die hohe Achtung, in der die hervorragende Krefelder Mennoniten-Familie stand, wird dadurch deutlich, daß der Preußenkönig Friedrich II. während des Siebenjährigen Krieges bei ihr Quartier nahm und es dem Kommerzienrat Friedrich von der Leyen gelang, den König zur Einrichtung einer regelmäßigen Post zwischen Krefeld und Berlin zu bewegen.
Andererseits blieb er standhaft gegenüber dem Preußenkönig, der die von der Leyens auf eine Verlagerung Krefelder Seidenwebereien in die Mark Brandenburg drängte. Keine noch so großzügige Förderung konnte damals die niederrheinischen Untenehmer dazu bewegen, ihr Gebiet zu verlassen, das im 18.Jahrhundert in Mitteleuropa am dichtesten besiedelt und in der
Textilfabrikation und im Metallgewerbe am stärksten industralisiert war. Wie kam es nun dazu, daß Johann David Herstatt bankgeschäftliche Aufgaben übernahm, da er doch als Industrieller und erfahrener Handelskaufmann bereits in sein fünftes Lebensjahrzehnt trat. Als Protestant hatte er in Köln nur wenig berufliche Ausweichmöglichkeiten, nachdem er wegen konfessioneller Intrigen und angesichts der Einstellung der Zünfte gegen Großbetriebe erster kapitalistischer Prägung seine Textilfabrik bis zur Unwirtschaftlichkeit verkleinern mußte. Es lag deshalb u. a. nahe, allmählich in das zunftfreie Gewerbe der Bankiers überzuwechseln. Hierzu mögen ihn aber auch seine einflußreichen Glaubensbrüder, die Bankiers Peltzer und von Recklinghausen, überredet haben, die wie sein Vater eine führende Rolle im Kölner Konsistorium spielten. Die Peltzers stammten aus dem Eschweiler benachbarten Stolberg, wo in den dreißiger Jahren zwei Söhne Herstatt-Töchter geehelicht hatten. Die Familie von Recklinghausen war um die Jahrhundertwende ebenfalls in Eschweiler anzutreffen. Zudem hatte der Bankier A. von Recklinghausen bei der Taufe von Johann David Herstatt den Paten Peter David Welter vertreten. Ferner könnte Johann David von Wilhelm Johann von Wecus beeinflußt worden sein, der im Kölner Adreßbuch von 1797 als >Rathsverwandter, Stimmeister, Rathsrichter und Kriegs-Commissarius, Pulver-Fabrikant, Spediteur<, aber auch als Wechselbanquier aufgeführt ist, und der Besitzer des obengenannten ersten Kölner Wohnhauses der Familie Herstatt auf der Hohe Pforte war. In den Annalen werden die beiden erstgenannten Bankiers neben den Häusern von Meinerzhagen, von Hack und von Frantz zu den kurfürstlichen Hofbankiers des 18. Jahrhunderts gezählt, welche die über ein halbes Jahrtausend alte Kölner Finanztradition fortführten. Über die Kölner Finanzgeschichte und die Rolle der Hofbankiers schreibt Krüger in dem erwähnten Buch (Zur Geschichte des Kölner Bank- und Geldwesens sei auch auf das entsprechende Kapitel Seite 86ff. verwiesen) :
>Auf der Höhe des Mittelalters war Alt-Köln, gestützt auf die unverwüstlichen Vorteile seiner wirtschaftsgeographischen Lage, zu einem bedeutsamen Brennpunkt im nordwesteuropäischen Kreislauf des internationalen Güteraustausches emporgestiegen. Es
war die Zeit, da die Reichsstadt ein gewichtiges Wort sowohl bei der Entstehung und Organisation als auch bei der Machtentfaltung der zwischenstädtischen Welthandelsgemeinschaft der deutschen Hanse sprach, die Zeit, da - wie ein angesehener Kölner Wirtschaftspraktiker (Schüll) sich um 1800 äußerte- : Kölns Halbmond unter den ersten Gestirnen der Handelssphäre glänzte
.
Der blühende Warenhandel ließ damals beträchtliche Kapitalhäufungen innerhalb der reichsstädtischen Mauern erstehen, die früh, und zeitweilig in breitem Strom, den Weg in die Kanäle bankgeschäftlicher Betätigung fanden. Jenes Bankgeschäft wurde bei den
bescheidenen Anforderungen der herrschenden Wirtschaftsordnung durchaus bestimmt und getragen von der Anspruchsfülle und Vielseitigkeit öffentlicher, voran staatlicher Finanzgebarung. Auf diesem Arbeitsfeld wußte der Kölner Warenkaufmann und Ban-
kier nachweislich bereits im 13. und 14. Jahrhundert, also lange vor dem Aufstieg der oberdeutschen Finanzmächte der Fugger und Welser, auf Grund seiner weitgedehnten und einflußreichen Wirtschaftsbeziehungen eine führende Stellung hinsichtlich des nordwesteuropäischen Anleihemarktes zu erringen. Neben der Finanzierung des westdeutschen, niederländischen und skandinavischen hat er insbesondere für geraume Zeit die des englischen Staatskredits getätigt und sogar beherrscht. Die Verpfändung von Kronjuwelen*) und die Abtretung von Zolleinkünften, die Erteilung wertvoller Handelsprivilegien und die starke Einflußnahme der Kreditgeber auf den englischen Metallbergbau beleuchten die Tragweite jener Finanzgeschäfte. Seit dem Ende des Mittelalters setzte dann der Verfall der wirtschaftlichen Blüte Kölns ein. Die durch die überseeischen Entdeckungen eingeleiteten weltwirtschaftlichen Schwergewichtsverschiebungen von den europäischen Gewässern nach den großen Ozeanen, einhergehend mit der zunehmenden wirtschaftlichen Verselbständigung und politischen Erstarkung der hanseatischen Interessengebiete, brachen, unterstützt durch innere Zwietracht in jenem Bunde, dessen Macht und untergruben zugleich die betonte Handelsstellung Kölns. Mit ihren der Rheinstadt zum Teil vorgelagerten Seehäfen traten die auf kolonialen Grundlagen im tropischen Asien und der neuen Welt fußenden, kraftvoll aufstrebenden west- und nordwesteuropäischen Volkswirtschaften als Mittler zwischen Welt- und kontinentalem Binnenmarkt auf und bevormundeten die ehedem weltwirtschaftlich selbständige Reichsstadt. Der hierdurch verursachte wirtschaftliche Stillstand und Rückgang wurde gefördert und konserviert durch die fast gleichzeitige Verlegung des wirtschaftlichen Schwergewichts Deutschlands vom Westen nach dem ursprünglich kolonialen Osten, durch die staatspolitischen Gestaltungen der neueren Zeit, die immer ärger ins Kraut schießende territoriale Zersplitterung im Reiche mit ihren wirtschaftlich lähmenden Rückwirkungen, die lokalen Fehden und europäischen Kriege, die vorzugsweise in den Rheinlanden ausgetragen wurden, und endlich durch die Entartungen in der inneren reichsstädtischen Wirtschaftspolitik.
All das verfehlte nicht seinen Einfluß auf die Stellung Kölns als Finanzplatz. Von dem hervorragenden Anteil an der Beherrschung des Kapitalmarktes büßte das Bankgeschäft in der Folge unter dem übermächtig werdenden Wettbewerb neugekräftigter Mittel-
punkte für die Befriedigung des finanziellen Staatsbedarfs in erheblichem Maße zu deren Gunsten ein. Das Erbe fiel über Augsburg, Lyon, Antwerpen hinweg im 17.Jahrhundert schließlich Amsterdam zu. Allerdings blieb das Kölner Finanzkapital noch stark und ein flußreich genug, um nicht gänzlich vom Markt verdrängt zu werden. Nur schrumpfte sein Aktionsradius auf die umliegenden Gebiete des deutsch-kleinstaatlichen Auslands zusammen, denen gegenüber es sich jedoch eine beachtenswerte Rolle zu erhalten vermochte.
Das Kölner Bankkapital des 18. Jahrhunderts folgte den Spuren der geschilderten Überlieferung. Es pflegte insbesondere rege Beziehungen zu den an chronischer Geldverlegenheit leidenden Rheinstaaten Kurköln und Jülich-Berg sowie dem nieder- rheinischen Adel. Auch gewann es Fühlung mit anderen Territorien der westdeutschen Grenzmark, wie Kurtrier und Preußen, das in Cleve-Mark Fuß gefaßt hatte. Diese Beziehungen scheinen sich jedoch auf solche beschränkt zu haben, die dem Zahlungsverkehr der letztgenannten Staaten entsprangen. Dagegen wurde der reichsstädtische Bankier von Kurköln und
Jülich-Berg nach wie vor für teils kurz-, teils langfristige Kreditgeschäfte weitgehend herangezogen. Des öfteren nahm deren finanzieller Bedarf infolge zahlreicher Kriegsverwicklungen- spanischer und österreichischer Erbfolgekrieg, Siebenjähriger Krieg!-,
von Landkäufen, wachsenden Verwaltungsausgaben und ungebührlich gesteigerten Ansprüchen ihres in Prachtentfaltung vielfach wenig sparsamen Hoflebens ungewöhnliche Ausmaße an, die in keinem Verhältnis zur Ergiebigkeit der regelrechten Landeseinkünfte standen. Die gewährten Kredite kletterten im Einzelfalle nicht selten auf Beträge bis zu Rtlr. 200 000,-, und man sorgte sich bei entstehenden Differenzen, ein gütliches Einvernehmen mit den Kölner >Hof<-Bankiers zu erzielen.
Bei den ausgesprochen langfristigen Kreditgeschäften, die sich in der Regel in die Form der persönlichen Generalobligation der Fürsten kleideten, sind den Kölner Bankiers zur dinglichen Sicherstellung ihrer Forderungen noch Landesgefälle, Juwelen und
Kostbarkeiten >specialiter verhypothesiert und verschrieben< worden. Die Mehrzahl der gewährten Kredite waren allerdings reine Personal-, und zwar Wechselkredite. Das erklärte sich vor allem aus den durchweg engen persönlichen Beziehungen, die sich zwi-
schen den Kölner Bankiers und den Höfen entwickelten. Sie waren als Hofbankiers und Hofagenten Vertraute der Fürsten, wurden kurfürstliche Pfenngmeister und selbst Hofräte.
An die Kreditgeschäfte mit den Rheinstaaten reihten sich, vielfach mit ihnen verbunden, diejenigen Geschäfte, die sich aus dem laufenden Zahlungsverkehr der fürstlichen Kassen ergaben. Dieser Zahlungsverkehr bewegte sich in großem Maßstabe durch die Kontore der Kölner Hofbankiers. Sie besorgten die Einziehung von Landeseinkünften, ihre Auszahlung gegen Wechsel umd Assignationen, sodann den Überweisungsverkehr zwischen kurfürstlichen Generalkassen und denen anderer geistlicher und weltlicher Herren, die Vermittlung und Auszahlung von Subsidien und Bestechungssummen, von Konkurrenz- und Militärgeldern, endlich die Umwandlung von Bareingängen in die jeweils benötigten Münzsorten.
Jene kurfürstlichen Hofbankiers- die Häuser von Meinerzhagen, von Hack, Peltzer, von Frantz und von Recklinghausen- erhielten der Reichsstadt bis zum Ablauf des Siebenjährigen Krieges ihre Eigenschaft als hauptsächliche Hilfsquelle für die rheinischen
Staatsfinanzen. In Anerkennung dieser Eigenschaft entschloß sich auch Jülich-Berg, bei der Errichtung seiner Staatsbank im Jahre 1706 - des >banco di gyro d'affrancatione< nicht die damalige Landesstadt Düsseldorf, sondern das ausländische Köln als deren Sitz zu wählen< (Krüger).
Neben den Bankiers Meinerzhagen und Hack zählte wohl auch der Bankier Johann Heinrich Sybertz zu den >kurfürstlichen Banconegotianten<. Auf Banko-Zetteln, die den Charakter eines Wechselbriefes und wegen der häufigen Girierung und hohen Zirkulation zeitweilig die Natur von Papiergeld besaßen, war,,]ohann Heinrich Sybertz wohnhaft in Cölln auf der hohen
Pforten< als Adresse für die Einlösung angegeben. Der Bankier Sybertz bewohnte in der ersten Hälfte des 18. ]ahrhunderts das Haus Hohe Pforte Nr. 25/27 an der Ecke der Sternengasse. In dieses Haus siedelte Johann David Herstatt über, nachdem er sein Geburtshaus Hohe Pforte 9, wahrscheinlich kurz vor der Umbenennung der Firma auf seinen Namen im ]ahre 1782, verlassen hatte. Es ist ein bemerkenswerter Zufall, daß das ständige Domizil des alten Bankhauses J. D. Herstatt bereits zu Beginn des 18. ]ahrhunderts Sitz, zumindest aber bedeutende Geschäftsstelle einer kurfürstlichen Depositen- und Zettelbank war.
Als ]ohann David Herstatt bankgeschäftliche Interessen aufzunehmen begann, kam dem Finanzplatz Köln fast nur noch lokale Bedeutung zu. Nach Beendigung des Reichskrieges gegen Friedrich den Großen von Preußen hatten sich die überschuldeten, in ihren Finanzen zerrütteten Rheinstaaten nach und nach dem durchorganisierten Kapital- und Kreditmarkt Amsterdam und dem ergiebigeren Wechsel- und Anleihenmarkt Frankfurt am Main zugewandt. Der Kölner Wirtschaft fehlten im ausgehenden 18. Jahrhundert jegliche Impulse, um eine Kapitalneubildung in Gang zu halten. Sie allein hätte der Reichsstadt die Teilnahme an den sich mächtig entwickelnden staatlichen Effektengeschäften gestattet. Erst in der 1794 beginnenden französischen Zeit verloren die selbstgenügsamen Zünfte ihre vierhundertjährige wirtschaftspolitische Machtstellung. In dieser wirren Notzeit wurde in Köln manches alte Tabu zerbrochen, das eine fortschrittliche Entfaltung des Wirtschaftslebens jahrzehntelang gehemmt hatte.
Gewiß hatte die Einführung der Assignatenwirtschaft -schon in der ersten Woche der Besetzung durch die Revolutionsarmee wurde das Münzgeld als Zahlungsmittel verboten und durch das bereits wertlos gewordene Revolutionsgeld, die Assignaten, ersetzt- in der Kölner Bürgerschaft zu empfindlichen Vermögensverlusten geführt. Andererseits hatte die Säkularisierung der Güter aus toter Hand sowie die in der Folgezeit einsetzende Veräußerung enteigneten Gebäude- und Grundbesitzes eine mit regem Immobilienhandel verbundene Umschichtung der Vermögensverhältnisse zur Folge. Dieser krasse Eingriff in die Besitzstruktur
sollte sich später als eine fruchtbare Befreiung des Kapitals für die einsetzende Industrialisierung erweisen. Auch erfuhr das soziale Gefüge in dieser Zeit grundlegende Veränderungen.
In diesem Zusammenhang interessiert hier vor allem die Befreiung nichtkatholischer Bürger von allen bis dahin gültigen persönlichen und beruflichen Beschränkungen. So wurde künftig auch Protestanten das Bürgerrecht verliehen und der Erwerb von Grund- und Hausbesitz gestattet.
Für Johann David Herstatt waren erst jetzt die Voraussetzungen für eine volle Entfaltung seiner bankgeschäftlichen Tätigkeit gegeben. Bereits vor der Franzosenzeit hatte er ein hohes Ansehen erlangt. Dem Altonaischer Mercurius< vom 1. Februar 1793 ist zu entnehmen, daß der Königl. Agent zu Cöln, Joh. David Herstatt, zum dänischen Residenten daselbst und in den
Städten des Niederrheinischen und Westphälischen Kreises, wie auch bey dem Churfürsten von Cöln ernannt worden ist. Diese Ernennung dürfte wohl auch auf die erwähnten guten Beziehungen des Hauses von der Leyen zum preußischen Königshaus zurückzuführen sein.
Für Johann David Herstatt mag diese überregionale königliche Agententätigkeit in der späteren Franzosenzeit von Vorteil gewesen sein. General Hoche hatte 1797 Köln zum Sitz der französischen Niederrheinarmee bestimmt, wodurch die ehemalige Reichsstadt aus ihrer bisherigen Isolierung befreit wurde.
Johann David Herstatt gehörte zu den Persönlichkeiten, deren allgemeine Anerkennung selbst in der Revolutionszeit bestehen blieb. Es ist sonst kaum zu erklären, daß der frühere preußisch königliche Resident bereits im September 1797 bei der Gründung eines Handlungstribunals von den Kölner Bürgern als Handelsrichter vorgeschlagen und vom französischen Regierungskommissar neben Abraham Schaaffhausen und drei anderen Kaufleuten hierzu auch ernannt wurde. Im gleichen Jahr, und zwar am 8. November, gehörte Johann David auch zu den Mitbegründern des Handlungsvorstandes, aus dem sich 1803 die älteste und auf Jahrzehnte einzige deutsche Handelskammer entwickelte. Von den öffentlichen Ämtern, die Johann David Herstatt bekleidete, ist nur noch seine Tätigkeit als Präfekt des Roer-Departements nach 1802 bekannt.
Für seine Tätigkeit als Bankier gibt es außer der Nennung des Titels in verschiedenen Dokumenten fast keine Zeugnisse. Erwähnt sei hier nur ein Kreditbrief, der einem Schriftwechsel zwischen J. D. Herstatt und dem Rat der Stadt Köln aus dem Jahre 1796 entnommen ist. Kreditbriefe dieser Art waren seit jeher auch im internationalen Verkehr übliche Zahlungsanweisungen. Der Begünstigte konnte sich an einem oder mehreren bestimmten Orten bei gewissen Korrespondenten des betreffenden Bankiers Beträge bis zu einer festgesetzten Höhe gegen Quittung auszahlen lassen. Nach der erwähnten Kreditbrief-Nota hatte der Rat der
Stadt Köln bei einem ausländischen Korrespondenten J. D. Herstatts einen Kredit von 300.000 livres in Assignaten in Anspruch genommen.
Am 2. Januar 1809 starb der Gründer der Bank, Johann David Herstatt. Er wurde auf dem Friedhof Weyertal im Familiengrab seiner Eltern bestattet. Der Grabstein ist bis heute erhalten geblieben und trägt die Namen der ersten beiden Generationen der Kölner Herstatt Linie. Der älteste Sohn, Friedrich Peter Herstatt, der sich nach seiner Verheiratung mit Friederieka von der Leyen im ]ahre 1801 Herstatt-von der Leyen nannte, übernahm die Geschäfte des Bankhauses. Er soll bereits 1800 als Fünfundzwanzigjähriger in das väterliche Bankgeschäft eingetreten sein. Friedrich Peter Herstatt-von der Leyen hat gemeinsam mit seinem Schwager Ludwig Gottfried von den Westen, der von 1798 bis 1824 die Geschäfte der Bank als Teilhaber mitleitete, den raschen Aufstieg des Hauses bewirkt.
Wie sein Vater betrieb Friedrich Peter zur Stärkung der Kapitalkraft mit großem Erfolg die aus der Franzosenherrschaft herrührenden Immobiliengeschäfte. Zu derartigen Geschäften war auch noch reichlich Gelegenheit geboten, nachdem Rheinland und Westfalen 1815 vom Wiener Kongreß der Preußischen Krone zugesprochen wurden. Der preußische Staat nahm aus seinem Domänenbesitz in großem Stil Entschädigungen für Grundbesitzverluste aus der französischen Zeit vor; ein Teil der Entschädigten veräußerte aber sogleich die zugewiesenen Ländereien. Da der Ankauf der Domänen einen großen Umfang annahm und die Veräußerung nur parzellenweise möglich war, erfolgte der lukrative Umsatz der großen Ländereien meist gemeinsam mit A. Schaaffhausen. Es ist noch eine Urkunde vorhanden, in der J. D. Herstatt und A. Schaaffhausen gemeinsam einen Generalbevollmächtigten für diese Grundstückstransaktionen ernannten. Danach ist anzunehmen, daß sich die jungen Bankhäuser aus dem Immobilienhandel auf eigene Rechnung allmählich zurückzogen und ausschließlich eine Finanzierungsfunktion übernahmen.
Über den weiteren Aufbau sowie die spätere Entwicklung der alten Herstatt-Bank sind nahezu keine Originalquellen mehr vorhanden. Alfred Krüger hatte bei der Abfassung seines Buches Das Kölner Bankiergewerbe vom Ende des 18.Jahrhunderts bis 1875< noch das J. D. Herstatt betreffende Quellenmaterial studieren können, das inzwischen vor allem im letzten Krieg verlorengegangen ist. Es sei deshalb im folgenden die Darstellung im Krügerschen Buch zitiert :
Der Ankauf von Ländereien ist wenngleich in geringerem Umfange- auch in den zwanziger Jahren fortgesetzt worden, während die Abwicklung all jener Geschäfte sich noch bis ins 4.Jahrzehnt hingezogen hat. Ihre Ergiebigkeit kann nicht stark genug unter-
strichen werden. Was der Assignaten-Schwindel, was Kontributionen, außerordentliche Steuern und Zwangsanleihen der Kapitalkraft des Hauses in der fanzösischen Zeit genommen hatten, ließ sich auf diesem Wege reichlich wieder wettmachen. Das Eigenkapital, dessen Höhe nach Kontributionsveranlagungen im Jahre 1796 bereits erheblich über 100.000 Reichstaler gelegen haben muß, belief sich um 1810 nach einer rohen Schätzung der Handelskammer auf rund 1 Million französischer Franken gleich etwa 260.000 Taler.
Die Ausbildung des Bankgeschäfts wurde von J. D. Herstatt in den zwanziger und dreißiger Jahren eifrig durchgeführt. Neben das alte Wechselgeschäft trat immer ausschlaggebender die Kreditgewährung in laufender Rechnung. Sie wurde und blieb in
aller Folgezeit das Hauptbetätigungsfeld des Hauses. Die branchenmäßige Zusammensetzung der Kontokorrent-Kundschaft erfuhr ebenso wie die allgemeine Geschäftsrichtung eine wesentliche Verschiebung. Wie in den beiden ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts, so verkörperte J. D. Herstatt auch noch um 1870 das typische Kreditinstitut der mittelständisch gearteten Textilindustrie am linken Niederrhein und im Bergischen Land. Auch Kölner Privatfirmen von bedeutendem Namen, vor allem Felten & Guilleaume und F. W. Brügelmann Söhne, sind unter Herstatts Hilfe herangereift. Im Bereich der Montanindustrie sind nennenswerte Beziehungen nur zur Hütte Vulkan bei Duisburg, ab 1856 Vulkan A.G. für Hüttenbetrieb und Bergbau, und zum Deutsch-Holländischen Aktienverein für Hütenbetrieb und Bergbau zu Duisburg - Johannishütte- angeknüpft worden. Friedrich Krupps erster und langehin einziger Bankier war J. D.Herstatt.<
Alfred Krupp, der Sohn des Gründers der Firma Fried. Krupp, hatte sich 1834 auf Vermittlung seines Vetters Carl Friedrich von Müller an das Haus J. D. Herstatt zur Aufnahme einer Geschäftsverbindung gewandt. Das Bankhaus Herstatt übernahm die Abrechnung, vor allem des Wechselgeschäfts, mit süddeutschen Firmen. C. F. von Müller hatte zur Sicherung der Herstatt-Kredite zeitweilig sein Gut Metternich an das Bankhaus verpfändet. 1838 trat Alfred Krupp, mit einem Kreditbrief des Bankhauses Herstatt über 2.000 Rubel in der Tasche, eine Reise nach Rußland an. Im Jahre 1842 bewilligte das Bankhaus Herstatt Fried. Krupp
einen Kredit von 15.000 Talern, der durch eine Hypothek auf die Gußstahlfabrik abgesichert war. Er wurde 1851, nachdem der Kruppstahl auf der Londoner Weltausstellung im Kristall Palast Weltruf erlangt hatte, getilgt. Die Bankverbindung mit Herstatt blieb auch später lange bestehen, nachdem von 1849 an auch Sal. Oppenheim & Cie. sowie später der Schaaffhausensche Bankverein Hausbanken von Fried. Krupp wurden.
Andere Vorkämpfer der modernen Eisenindustrie Friedrich Harkort, Franz Dinnendahl haben J. D. Herstatt gleichfalls früh in Anspruch genommen. Dauerhaftere Verbindungen entwickelten sich mit Unternehmen dieses Wirtschaftszweiges auch nur in
geringer Zahl. Aus ihrer Reihe verdienen Erwähnung diejenigen mit den Eisen- und Stahlwerken Gebr. Reusch in Hoffnungsthal, Funcke und Elbers in Hagen, Asbeck & Co., später Asbeck, Osthaus, Eicken & Co. in Hagen, endlich E. Böcking & Co. in
Mülheim am Rhein.
Später kamen u. a. auch die Gebr. Stumm in Neunkirchen hinzu.
Die Unterstützung junger Unternehmungen der chemischen Industrie, voran J. W. Weiler bei Köln, die spätere A.-G. Chemische Fabriken vorm. Weiler-terMeer, Uerdingen, und die Farbwerke Meister Lucius & Brüning zu Höchst am Main, wird auf Anregungen zurückgeführt werden können, die aus der intensiven Pflege der Faserstoffgewerbe und ihrer Nachbargebiete, wie Färberei und Druckerei, entsprangen.
Die Finanzierung großkapitalistischer Wirtschaftseinheiten in Gestalt der Aktiengesellschaften ist im 4. und 5. Jahrzehnt, der Zeit ersten stärkeren Umsichgreifens dieser Unternehmungsform, von J. D. Herstatt mehrfach mitübernommen worden. Unmittelbar schöpferisch, d. h. durch Zugehörigkeit zu Gründungs- und Unlwandlungskomitees, trat J. D. Herstatt allerdings nur bei der Entstehung der ersten Eisenbahn- undVersicherungsgesellschaften in Köln sowie der Kölnischen Privatbank hervor. Umfang-
reicher war die Mitwirkung bei Emissionsgeschäften, wobei Aktien und Obligationen heimischer Verkehrs- und Versicherungs- unternehmungen im Vordergrund standen.<
Da die Finanzierung der Gründung und Entwicklung der rheinischen Großunternehmungen die Kapitalkraft der einzelnen Kölner Privatbanken überschritt, fanden sich die vier Kölner Institute J. D. Herstatt, J. H. Stein, A. Schaaffhausen und Sal. Oppenheim jun. & Cie. schon früh zu einem Konsortium zusammen. Bereits 1818 gründeten die vier Banken gemeinsam die Rheinschiffahrts-Assekuranz-Gesellschaft in Köln mit einem Kapital von 750.000 südd. Gulden. Diese Gesellschaft, mit der die große Geschichte der rheinischen Versicherungswirtschaft begann, wurde 1845 in die, Agrippina, Kölnische Transport-
versicherungs-Gesellschaft umgewandelt und mit einem Aktienkapital von 2.000.000 Talern ausgestattet. Schwieriger war die Aufbringung des 3.000.000 Taler betragenden Gründungskapitals der, Colonia, Kölnische Feuerversicherungs-Gesellschaft, im Jahre 1839. Der Kapitalmarkt war gerade durch die Rheinische Eisenbahn stark beansprucht worden und in eine Baisse-Entwicklung geraten. Da die Subskriptionskraft des Kölner Konsortiums, dem inzwischendas Bankhaus Seydlitz & Merkens beigetreten war, nicht ausreichte, wurden durch Vermittlung von Oppenheim das Pariser und Frankfurter Haus Rothschild hinzugezogen. J. D. Herstatt hat ferner bei der Gründung der ersten deutschen Rückversicherungsgesellschaft, der Kölnische
Rückversicherungs-Gesellschaft (A. K. 3.000.000 Taler) mitgewirkt sowie ebenfalls bei der Konstituierung der Kölnische Hagelversicherungs-Gesellschaft (A. K. 2.000.000) im -Jahre 1853 gemeinsam mit der zwei Jahre zuvor gegründeten Concordia<, Kölnische Lebensversicherungs-Gesellschaft (A. K. 10.000.000) und dem um das Kölner Bankhaus A. & L. Camphausen erweiterten Konsortium.
Beim Aufbau der großkapitalistischen Eisenbahnunternehmen haben sich die Kölner Banken, wie ein Historiker schreibt, durchaus als Urheber, Gründer, Erbauer der verkehrswichtigen Gesellschaften gefühlt, für die sie Einsatzbereitschaft zeigten, Opfer bis zur Gefährdung ihres eigenen Fortbestandes gebracht haben. Von den großen Eisenbahngründungen der dreißiger
und vierziger Jahrc, die unter Beteiligung von J. D. Herstatt erfolgten, verdienen Erwähnung die Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft (Aktienkapital 3.000.000 Taler) 1837, deren Netz sich bei der Verstaatlichung 1880 in weitverzweigter Verästelung von der lothringischen Grenze über ganz Rheinland-Westfalen bis in die Nähe der Nordsee-Häfen erstreckte, die Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft (Aktienkapital 13.000.000 Taler) 1843, ferner 1841 die Bonn-Kölner Eisenbahn-Gesellschaft (Aktienkapital 876.000 Taler), 1851 die Köln-Coblenz-Bingener Eisenbahn-Gesellschaft (Aktienkapital 10.000.000 Taler), die Köln-Crefelder Eisenbahn-Gesellschaft (Aktienkapital 1.100.000 Taler) sowie die Rhein-Nahe Eisenbahn, Saarbrücken. Meist blieb es nicht nur bei der Beschaffung und Beteiligung am Gründungskapital, sondern vor allem im Falle der Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft hatte sich das Haus Herstatt gemeinsam mit den anderen Kölner Bankiers für die Unterbringung zahlreicher Kapitalerhöhungen und Anleihen der Unternehmen verwendet. An den großen internationalen Eisenbahn-Finanzierungsgeschäften, die vor allem von Sal. Oppenheim jun. & Cie. sowie vereinzelt auch von Deichmann & Co. getätigt wurden, und die vor allem die verkehrsmäßige
Aufschließung Rußlands, Österreich-Ungarns, Italiens sowie Belgiens und Hollands in Gang brachten, hat sich das Haus Herstatt nicht mehr beteiligt. In der zweiten Jahrhunderthälfte zog sich J. D. Herstatt allmählich von den Gründungs- und Plazierungs-
projekten zurück.
Auch an der Wiege der Rheinschiffahrt hatte J. D. Herstatt als Pate gestanden. Hier sind die Entstehung der Preußisch-Rheinischen Dampfschiffahrt-Gesellschaft in Köln (Aktienkapital 616.800 Taler) 1825 sowie die Gründung der Kölnischen Dampfschleppschiffahrt-Gesellschaft (Aktienkapital 300.000 Taler) im Jahre 1841 zu nennen.
Auf dem Gebiet der Finanzierung des öffentlichen Kredits beteiligte sich J. D. Herstatt unter anderem bei den Emissionen folgender Staats- und Stadt-Anleihen :
4 % Preußische Staatsanleihe -- 1853
5 % Deutsche Bundes-Anleihe -- 1870/71
5 % Deutsche Bundes-Schatzanweisungen -- 1870/71
5 % Kölner Stadtanleihe -- 1849
4 % Kölner Stadtanleihe -- 1855
4 % Konvertierungs-Anleihe der Stadt Köln -- 1861
4 1⁄4 % Kölner Stadtanleihen -- 1868/71.
Zahlreiche Chancen, die Herstatt-Bank zu einer internationalen Konsortialbank zu entwickeln, haben nach dem Tode von Kommerzienrat Friedrich Peter Herstatt-von der Leyen 1851 sein ältester Sohn und Firmeninhaber Geheimer Kommerzienrat Johann David Herstatt und nach dessen Hinscheiden 1879 Friedrich Johann David Herstatt - wie es scheint - bewußt nicht wahrgenommen, um ihre Kapitalkraft hauptsächlich im Kreditgeschäft einzusetzen.
Krüger schreibt zu der Entwicklung der Herstatt-Bank in der dritten und vierten Generation:
Seit Ende der 1850er Jahre zog man sich dann vollkommen vom Gebiet des Gründungs-, Umwandlungs- und Komissionsgeschäfts zurück, um lediglich den Zahlstellendienst in begrenztem Ausmaße aufrechtzuerhalten, sich dafür andererseits aber, gestützt auf eine auserlesene, vorwiegend dem privaten Untemehmertum angehörige Kundschaft, mit aller Kraft auf das Kontokorrentgeschäft zu verlegen. Demgemäß hat das Haus auch in der Besetzung von Verwaltungsratsstellen und dem damit verbundenen Streben nach Abhängigmachung auf dem Aktienprinzip beruhender Unternehmungen nie eine bezeichnende Rolle gespielt.
Die eigene Kapitalkraft der Firma hat ihr leicht über die verschiedenen Krisenjahre des behandelten Zeitabschnittes, von denen anscheinend nur das Jahr 1848 Schwierigkeiten auslöste, hinweggeholfen. War sie um 1810 mit mehr als 1⁄4 Million Taler schon als recht erheblich anzusprechen, so erreichte sie um 1875 trotz mehrfacher großer Erbabgänge eine Höhe von etwa 5 Millionen Taler und sicherte J. D. Herstatt im Verein mit umfangreichen fremden Mitteln einen ersten Platz innerhalb der Kölner Bankwelt.
Den raschen Aufstieg um 1800 verdankte das Bankhaus sowohl seinem Stammvater Johann David Herstatt als auch dessen Sohn Friedrich Peter Herstatt-von der Leyen und dessen Schwiegersohn Ludwig Gottfried von den Westen, die im Wirtschaftsleben wie
im öffentlichen Leben Kölns einen bedeutenden Ruf genossen. Neben Johann David Herstatt jun. verfügte es von den dreißiger Jahren bis um die Jahrhundertmitte in Heinrich Ziegler über eine äußerst befähigte Teilhaberkraft.
Die Führerrolle, die J. D. Herstatt während des ersten Jahrhundertviertels in der Oberschicht des Kölner Bankgewerbes bekleidete, wurde ihm bald durch die Bankhäuser Sal. Oppenheim jun. & Cie. und A. Schaaffhausen streitig gemacht. Hier ausgeprägtester Initiativgeist mit wagemutigem Aufgreifen der neuen bankgeschäftlichen Zielsetzungen, dort abwägende Zurückhaltung mit dem Ziel sicherer und beharrlicher Kapitalanlage. Die äußerst solide Geschäftshandhabung der Firma J. D. Herstatt war um 1870 geradezu sprichwörtlich geworden. Aus dieser Einstellung wird sich auch die die Firma kennzeichnende allzeitige Wahrung strenger betrieblicher Isolierung erklären. Wohl haben gemeinsame Geschäftsinteressen ein Nebeneinanderauftreten mit befreundeten Bankhäusern -J. H. Stein, von der Heydt-Kersten & Söhne in Elberfeld, Baum, Boeddinghaus & Co. in Düsselclorf u. a. - im Gefolge gehabt. Es ist aber in keinem Falle, selbst nicht gegenüber dem J. D. Herstatt seit der französischen Zeit verwandschaftlich sehr nahestehenden Hause J. H. Stein, zu einem häufigeren, geschweige denn planmäßigen Zusammenarbeiten ausgebaut worden. Zum Aufkommen der Aktienkreditbanken stand man vollkommen neutral. Nicht einmal zur Direktion der Disconto-Gesellschaft in Berlin, der einzigen Kreditbank, bei deren Finanzierung J. D. Herstatt mitwirkte, sind nähere Beziehungen zwecks etwaiger geschäftlicher Zusammenarbeit angeknüpft worden.<
[http://www.finanzbahnhof.de/bh/her3.htm - 24 Jun 2001]
|
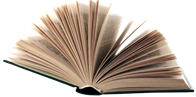

 [1]
[1] 
 gest. 21 Apr 1737, Eschweiler, (DE)
gest. 21 Apr 1737, Eschweiler, (DE)  (Alter 79 Jahre)
(Alter 79 Jahre)  gest. 4 Mrz 1729, Eschweiler, (DE)
gest. 4 Mrz 1729, Eschweiler, (DE)  (Alter 73 Jahre)
(Alter 73 Jahre)  gest. 11 Jun 1762, Köln, (DE)
gest. 11 Jun 1762, Köln, (DE)  (Alter 54 Jahre)
(Alter 54 Jahre)  [1]
[1]  (Alter 31 Jahre)
(Alter 31 Jahre) gest. 10 Mai 1758, Köln, (DE)
gest. 10 Mai 1758, Köln, (DE)  (Alter 26 Jahre)
(Alter 26 Jahre) gest. 18 Apr 1734 (Alter 1 Jahr)
gest. 18 Apr 1734 (Alter 1 Jahr) gest. 18 Mrz 1735, Köln, (DE)
gest. 18 Mrz 1735, Köln, (DE)  (Alter 0 Jahre)
(Alter 0 Jahre) gest. 30 Apr 1766, Köln, (DE)
gest. 30 Apr 1766, Köln, (DE)  (Alter 29 Jahre)
(Alter 29 Jahre) gest. 18 Sep 1753, Köln, (DE)
gest. 18 Sep 1753, Köln, (DE)  (Alter 14 Jahre)
(Alter 14 Jahre) gest. 2 Jan 1809, Köln, (DE)
gest. 2 Jan 1809, Köln, (DE)  (Alter 68 Jahre)
(Alter 68 Jahre) gest. 25 Mrz 1811, Köln, (DE)
gest. 25 Mrz 1811, Köln, (DE)  (Alter 68 Jahre)
(Alter 68 Jahre) gest. 25 Apr 1816, Köln, (DE)
gest. 25 Apr 1816, Köln, (DE)  (Alter 71 Jahre)
(Alter 71 Jahre) gest. 7 Nov 1814, Köln, (DE)
gest. 7 Nov 1814, Köln, (DE)  (Alter 68 Jahre)
(Alter 68 Jahre) gest. 25 Apr 1822, Köln, (DE)
gest. 25 Apr 1822, Köln, (DE)  (Alter 72 Jahre)
(Alter 72 Jahre)