| Notizen |
- Leopold Schoeller hörte 1852 von Whytocks Erfindung, die es möglich machte, hochwertige Teppiche preiswert maschinell zu weben. In Berlin webten bereits zwei Unternehmen gemusterte Teppiche nach Whytocks Verfahren, bezogen die farbigen Garne dafür allerdings aus Großbritannien. Der Textilunternehmer Schoeller sah den enormen Markt und seine Faszination für Technik dürfte ihn bestärkt haben. Sogleich reichte er die englische Beschreibung der Erfindung ein und sicherte sich 1852 ein preußisches Patent auf so genannte »Druckteppiche«. Er verwendete dann allerdings nicht Whytocks Verfahren, sondern große hölzerne Drucktrommeln. Die preußische Regierung begrü.te seinen Entschluss, denn je mehr Waren in Preußen hergestellt wurden, desto weniger Importe waren notwendig. Anders als die Berliner Konkurrenten wollte Schoeller allerdings nicht nur weben, sondern er wollte auch das Färben selbst übernehmen, also alle Herstellungsschritte vom Garn bis zum fertigen Teppich erledigen. Die erforderlichen Maschinen kamen zunächst überwiegend aus Großbritannien: Schoeller kaufte die Webstühle in der Textilstadt Manchester und die für die Färbung benötigten Drucktrommeln und Setzwagen in Halifax. Andere Maschinen lieferte der deutsche Hersteller Olfenius & Sickermann in Herford. Die Garne kaufte Leopold Schoeller zunächst bei der Schoeller’schen Kammgarnspinnerei in Breslau. Am 1. Juli 1854, als offensichtlich alle Voraussetzungen erfüllt waren, eröffnete Schoeller das »Teppichkontor« unter dem Dach seiner Tuchfabrik am Wirteltor. Noch war es keine eigene Firma, aber immerhin gab es eine eigene Leitung und Buchführung. Die Leitung des Kontors übertrug Leopold seinem vierten Sohn Philipp Eberhard Leopold Schoeller (1831–1896).
Die Anfänge der Teppichfabrik waren aus unterschiedlichen Gründen schwierig. Die Idee, die Garne aus der familieneigenen Kammgarnspinnerei in Breslau zu beziehen, erwies sich als ungünstig, denn die Breslauer Garne waren zwar qualitativ gut, aber wesentlich teurer als die entsprechenden englischen Sorten. Also bezog man ab 1869 doch englische Garne.Weitere Probleme kamen hinzu: Die Muster der Teppiche und die Farben überzeugten nicht. Und in der Produktion unterliefen noch viele Fehler, was beim kettmustergefärbten Teppich fatal war, denn er musste besonders exakt gefärbt und gewebt werden. Das Personal aus der Tuchfabrik war dafür noch nicht ausgebildet und die Qualität der Teppiche ließ daher zu wünschen übrig. Noch blieben die Teppiche aus Düren weit hinter der Konkurrenz aus England zurück. Vielleicht hatte Schoeller die Schwierigkeiten der Fertigung unterschätzt. Durch die vielfältigen technischen und personellen Probleme waren die Kosten im Verhältnis zur Zahl der hergestellten Teppiche zu hoch und die Fabrik kam nicht aus den roten Zahlen. In dieser Situation zog Vater Leopold Schoeller offenbar die Notbremse und übertrug 1867 die Leitung der Teppichfabrik seinem fünften Sohn Philipp Schoeller (1833– 1904). Leopold Schoeller junior siedelte nach Breslau über, um sich um die schlesischen Güter und Zuckerfabriken der Familie zu kümmern. [2]
|
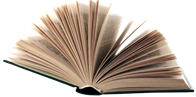

 gest. 18 Dez 1884, Düren, (DE)
gest. 18 Dez 1884, Düren, (DE)  (Alter 92 Jahre)
(Alter 92 Jahre)  gest. 10 Sep 1910, Breslau, (PL)
gest. 10 Sep 1910, Breslau, (PL)  (Alter 49 Jahre)
(Alter 49 Jahre)